Session in einem Jazzclub in New York: Man hat sich auf den sehr schnellen Standard „Cherokee“ geeinigt und dann im letzten Moment vor dem Einzählen wird die Tonart geändert … in Fis-Dur! Und dann kommst Du entweder mit oder eben nicht. An diese Art von Aufnahmeprüfung erinnert sich der junge Saxophonist Tobias Meinhart noch sehr gut. Eine ziemlich fiese Initiation, die stattfindet, weil die Stadt voller guter Musiker ist und eben nur die besten mitspielen dürfen bei den Sessions und auch sonst. Offensichtlich gehört Tobias Meinhart zu den Guten, denn immerhin ist der Regensburger jetzt schon 10 Jahre als Musiker in New York aktiv und auch an diesem Abend ganz am Anfang hat er sich ein „good job“ abgeholt bei den anderen Musikern. Harte Konkurrenz, ständiger Vergleich …
„Genau das wollte ich! Ich hab in Basel studiert und es war alles super, man hat alles gehabt, aber mir hat eben gefehlt, dass es viele gibt, die besser sind oder irgendwas gut können. Die ersten paar Jahre in New York war es so: Ich bin von einer Hürde zur nächsten gesprungen. Auf einer Session spielen alle auf einmal komplett nur ungerade Takte und ich konnte das gar nicht. Also habe ich nur noch das geübt. Oder auf der nächsten Session nur ganz schnell. Ich habe versucht, alles gut zu können, aber irgendwann musste ich dann realisieren – okay, man kann nicht alles gut können. Ich hab versucht, meine eigene Stimme zu finden und suche immer noch – ich bin ja noch jung.“

Heute Abend steht der 35jährige in der Unterfahrt in München auf der Bühne. Gemeinsam mit jungen Jazzern und einem Star der Szene an der Gitarre: Kurt Rosenwinkel. Der ist den umgekehrten Weg gegangen: Ein New Yorker, der jetzt in Deutschland lebt.
Sie spielen Musik vom neuen Tobias Meinhart Album „Berlin People“. In Berlin verbringt Meinhart mittlerweile die Sommer, entflieht dem 24/7-Lifestyle von New York und genießt dort den etwas langsameren Gang.
„Es ist entspannter, wesentlich entspannter. Irgendwann brauch ich auch mal einen Break von diesem ganzen Druck und so… Es gibt aber super viele Musiker, die genau aus dem Grund nach Berlin ziehen, weil es sehr viel Ähnlichkeit mit New York hat. Und es ist günstiger zu wohnen. Was ich in New York für mein Zimmer zahle, da kann ich mir im Sommer in Berlin eine Wohnung leisten. Man geht auch mal im Park ein Bier trinken. Für so was gibt’s in New York einfach keine Zeit, das ist immer nonstop.“
In New York muss Tobias Meinhart unterrichten, Touren und Gigs organisieren, üben, komponieren und dann auch noch ein bisschen Sport machen, damit er fit bleibt für diesen anstrengenden Alltag. In Berlin bleibt dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Kontemplation und das Schreiben von Songs. Die Stücke auf seinem Album „Berlin People“ handeln zum ersten Mal auch von realen Personen. Zum Beispiel „Alfred“, das er für seinen Großvater geschrieben hat. Der war auch Musiker, ein klassisch ausgebildeter Kontrabassist, der im Regensburg der Nachkriegszeit mit amerikanischen Musikern viel Swing gespielt hat. Dieser Großvater hat bei Tobias Meinhart auch das erste Interesse für Jazz geweckt, als er ihn zu Konzerten mitnahm.
„Da kann ich mich erinnern, er hat viel mit Big Bands gespielt und da hat er mich immer mitgenommen, aber mich haben dann die Saxophone so angemacht in der ersten Reihe, das hat alles so geblinkt. Der steht auf, spielt ein Solo, da wurde ich auch sehr visuell geprägt. Das war auf jeden Fall die erste Berührung.“

Die musikalische Früherziehung ging dann mit den vielen Angeboten in Regensburg weiter. Da gab es genügend Clubs und interessante Musiker – auch auf der Durchreise:
„Die hatten in einem Jazzclub monatlich das „Summit Jazz Orchestra“, wo sie auch immer ganz tolle Gastmusiker hatten aus den Staaten. Zum Beispiel an Clark Terry kann ich mich erinnern, da war ich vielleicht so 14, 15 und konnte dabei sein. Ich kannte den Direktor Christian Sommerer, der war da sehr aktiv, ging mit mir auf die Schule und der hat mich ein bisschen so unter seine Fittiche genommen. Da konnte ich eben in den Proben dabei sein und so Eindrückliches erleben z.B. mit Clark Terry, der mir Tipps und Tricks gezeigt hat oder auch Bob Brookmeyer. Und es war alles in Regensburg – des war schon gut.“
Die Heimatstadt war prägend, der Großvater auch. Doch nicht nur über ihn hat er ein Stück auf dem aktuellen Album „Berlin People“ geschrieben. Auch der pakistanischen Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai ist ein Stück namens „Malala“ gewidmet. Wie läuft das bei Tobias Meinhart mit dem Komponieren?
„Ich komponiere eigentlich immer am Klavier und versuche viel mit Singen zu arbeiten. Mir ist das Melodische sehr wichtig. Ich komponiere selten mit dem Saxophon – das finde ich schwierig teilweise, da kommt zu viel für mich noch irgendwie von den Fingern und weniger aus der Seele. Ich finde es ganz gut, dass ich ein bisschen limitiert bin am Klavier, denn dann muss ich wirklich alles hören und alles muss irgendwie aus der Seele kommen.“
Und erzwingen kann man aus seiner Erfahrung gar nichts:
„Wenn man es so forciert, sagt, okay, ich will jetzt unbedingt ein Uptempo-Stück schreiben oder ich will ein ungerades Stück schreiben. Die Stücke sind meistens okay, aber man hört immer, dass irgendwas nicht stimmt. Immer ist man eben nicht in dieser Mood oder inspiriert.“
In seiner Vorstellung sind alle Musiker und Künstler auf der Suche nach diesem „Flow“, der einen ins Unbewusste, Unkontrollierte führt.
„Wie kommt man in den Flow? Das ist beim Komponieren so oder auch auf der Bühne. Manchmal fließt es und man denkt nicht drüber nach und manchmal muss man sich auf seine Licks verlassen, weil es einfach nicht so gut läuft. Oder irgendwas stimmt nicht, der Sound oder irgendwas ist strange und dann ist es okay, aber es ist halt nicht die magic. Deswegen nehmen Leute Drogen oder manche machen halt Yoga, Meditieren. Mir hilft Sport oder vorher noch zu meditieren um in diesen Flow zu kommen.“
Der Abend in der Unterfahrt hat jedenfalls einen guten Flow, Meinhart gibt dem Stargast Kurt Rosenwinkel viel Platz. Er meint das offensichtlich ernst, wenn er sagt, dass er sich gerne von tollen Musikern inspirieren lässt, erzählt begeistert von den gemeinsamen Auftritten. Bei der Frage, ob „shooting stars“ der Szene wie Kamasi Washington dem Jazz im Allgemeinen und ihm als Saxophonisten im Besonderen eigentlich helfen, ist Meinhart allerdings ziemlich hin- und hergerissen.
„Ich würde sagen, alles, was den Jazz populärer macht, ist gut. Wenn dadurch Leute in die Unterfahrt gehen und sich auch ein anderes Konzert anschauen, finde ich das sehr gut. Was ich schwierig finde ist, wenn die ganzen Medien sich nur einen oder zwei rauspicken. Das finde ich in New York das Spannende: Diesen Hype gibt es dort nicht. Dort ist Kamasi Washington einfach ein sehr guter Saxophonist, aber dann kam ich hier rüber und auf einmal in jeder Tageszeitung überall vorne drauf war Kamasi Washington. Ich finde, es sollte halt ein bisschen breiter gefächert sein. Warum stürzt man sich mit aller Macht auf Einen. Das ist der Retter des Jazz. Das ist mir too much. Es gibt so viele Gute – warum schreibt man nicht mal über die und stellt die vor?“
Ist hiermit geschehen. Hat Tobias Meinhart denn sonst noch Wünsche für seine Zukunft? Wo sieht er sich in 5 Jahren?
„Hoffentlich noch mehr Touren mit dieser Band spielen. Generell bin ich eigentlich super happy, wie es gerade ist. Wenn es in fünf Jahren so ist wie jetzt, ist auch alles cool, aber gerne dürfen die Venues noch größer werden.“
(Anmerkung der Autorin: Dieser Artikel wurde bereits in der Septemberausgabe des „Jazzpodium“ veröffentlicht.)
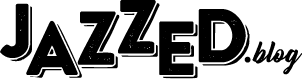

Schönes Interview! Ich halte die Augen auf, falls es einen Gig in Berlin gibt.